Was tun, wenn ein Vertragspartner Insolvenz anmeldet?
Wer einen Vertrag abschließt, vertraut darauf, dass die Vereinbarungen eingehalten werden und beide Seiten die Leistungen, zu denen sie sich vertraglich verpflichtet haben, ordnungsgemäß erbringen. Doch was, wenn der Vertragspartner auf einmal nicht mehr zahlungsfähig ist? Was tun, um sich vor den Folgen der Insolvenz zu schützen? Worauf gilt es bei Forderungsanmeldungen zu achten? Und was ist eine Insolvenzanfechtung?
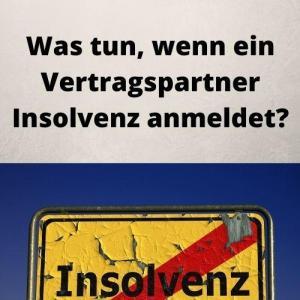
Wir klären auf!:
Inhalt
- 1 Was bedeutet Insolvenz?
- 1.1 Was passiert, wenn ein Vertragspartner Insolvenz anmeldet?
- 1.2 Ist es möglich, sich vor der Insolvenz eines Vertragspartners zu schützen?
- 1.3 Kann die Zahlungsfähigkeit eines Vertragspartners überprüft werden?
- 1.4 Worauf muss bei Forderungsanmeldungen geachtet werden?
- 1.5 Was ist eine Insolvenzanfechtung?
- 1.6
- 1.7 Ähnliche Beiträge
Was bedeutet Insolvenz?
Als Insolvenz wird bezeichnet, wenn einem Unternehmen oder einer Privatperson die Zahlungsfähigkeit droht. Die gesetzlichen Regelungen dazu finden sich in der Insolvenzordnung, kurz InsO.
Sie unterscheidet zwischen zwei Formen der Insolvenz. So gibt es zum einen die Regelinsolvenz, die Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften und Freiberufler, also Unternehmen und Firmen betrifft. Zum anderen gibt es die Verbraucherinsolvenz für Privatpersonen, die auch Privatinsolvenz genannt wird.
Tritt eine Insolvenz ein, wird ein Insolvenzverfahren eröffnet. Dazu erlässt das zuständige Insolvenzgericht einen sogenannten Insolvenzeröffnungsbeschluss. Für den Schuldner hat dieser Beschluss zur Folge, dass er das Recht verliert, sein Vermögen zu verwalten und darüber zu verfügen.
Stattdessen hat ein vom Gericht eingesetzter Insolvenzverwalter von nun an die Verfügungsbefugnis über das Vermögen, das zur Insolvenzmasse gehört. Das ist in § 80 InsO so geregelt.
Was passiert, wenn ein Vertragspartner Insolvenz anmeldet?
Ein Insolvenzverfahren hat nicht nur Auswirkungen für den insolventen Schuldner, sondern natürlich auch für seine Vertragspartner. Doch was ist, wenn sich ein Vertragspartner vertraglich zu Zahlungen oder Dienstleistungen verpflichtet hat und dann zahlungsunfähig wird?
In so einem Fall kommt es darauf an, ob und in welchem Umfang die vereinbarten Vertragsleistungen schon erbracht wurden. Sind sowohl beim Schuldner als auch bei seinem Vertragspartner noch Leistungen offen, kann der Insolvenzverwalter darüber entscheiden, ob der Vertrag fortgesetzt oder gekündigt wird.
Gemäß § 103 InsO kann der Insolvenzverwalter nämlich ein sogenanntes Wahlrecht oder auch Erfüllungswahlrecht ausüben. Ist ein Vertrag noch nicht oder noch nicht vollständig erfüllt, wenn das Insolvenzverfahren eröffnet wird, bestimmt also der Insolvenzverwalter darüber, ob der Vertrag bestehen bleibt oder ob er aufgelöst wird.
Anders sieht es aus, wenn eine Vertragspartei die Vertragsleistungen vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens schon komplett erbracht hat. Dann hat der Insolvenzverwalter kein Wahlrecht mehr.
Stattdessen bleibt der Vertrag bestehen und die andere Vertragspartei muss die vereinbarten Leistungen ebenfalls erfüllen. Ob die Insolvenzmasse ausreicht, um die Forderungen zu befriedigen, steht aber auf einem anderen Blatt.
Zum besseren Verständnis ein Beispiel:
Vertragspartner A hat ein Auto von Vertragspartner B gekauft. B ist in Vorleistung gegangen und hat das Auto an A übergeben. A hat den Kaufpreis noch nicht bezahlt, ist nun aber zahlungsunfähig. Der Insolvenzverwalter hat in dem Fall kein Wahlrecht.
Vielmehr bleibt der Vertrag bestehen und das Auto wird Teil der Insolvenzmasse. Vertragspartner B kann den Kaufpreis verlangen. Eine Garantie, dass er am Ende wirklich sein ganzes Geld bekommt, gibt es aber nicht.
Ist es möglich, sich vor der Insolvenz eines Vertragspartners zu schützen?
Wie das Beispiel zeigt, ist der beste Schutz vor den nachteiligen Folgen einer Insolvenz des Vertragspartners, den Austausch der Leistungen Zug um Zug zu vereinbaren. Vor allem wenn die finanziellen Verhältnisse des Vertragspartners nicht bekannt sind, ist es ratsam, nicht in Vorleistung zu gehen.
Stattdessen sollten die Leistungen nach dem Zug-um-Zug-Prinzip erfolgen. Im Beispielfall übergibt Vertragspartner B das Auto und bekommt im Gegenzug von Vertragspartner A den Kaufpreis.
Auf diese Weise lässt sich verhindern, dass der Vertragspartner seine vertraglichen Pflichten nicht mehr erfüllen kann, weil er pleite geht.
Ein Sonderkündigungsrecht für den Insolvenzfall gibt es nicht. Theoretisch ist es zwar möglich, eine Klausel in den Vertrag aufzunehmen, die ein Rücktrittsrecht für den Fall vorsieht, dass ein Vertragspartner insolvent wird.
Allerdings haben sich solche Klauseln in der Vergangenheit als rechtlich schwierig erweisen. Denn zum Teil stehen sie dem Erfüllungswahlrecht des Insolvenzverwalters entgegen.
Kann die Zahlungsfähigkeit eines Vertragspartners überprüft werden?
Konkrete Angaben über die finanziellen Verhältnisse eines Vertragspartners wird die andere Vertragspartei nur selten bekommen. Um sich abzusichern, ist aber möglich, zu überprüfen, ob gegen den Vertragspartner ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde.
Die Bundesländer haben dazu ein Portal eingerichtet, in dem alle eröffneten Verfahren und die dazugehörigen gerichtlichen Entscheidungen veröffentlicht werden.
Außerdem kann bei den Auskunfteien eine Bonitätsprüfung eingeholt werden. Sie gibt Auskunft über die Kreditwürdigkeit und das Zahlungsverhalten des Vertragspartners.
Worauf muss bei Forderungsanmeldungen geachtet werden?
Wird ein Insolvenzverfahren eröffnet, erhalten alle Gläubiger, die zu diesem Zeitpunkt finanzielle Forderungen gegen den Schuldner haben, die Aufforderung, ihre Ansprüche beim Insolvenzverwalter anzumelden. Die Frist dafür bewegt sich meist in einem Rahmen zwischen zwei Wochen und drei Monaten.
Die formalen Vorgaben für die sogenannte Forderungsanmeldung ergeben sich aus § 174 InsO. Demnach muss der Gläubiger seine Forderung schriftlich anmelden. Dabei muss er den Grund und den genauen Betrag angeben und die Forderung mit entsprechenden Nachweisen belegen. Auch eine Kopie des Vertrags, aus dem sich die Forderung ergibt, ist notwendig.
Ein Fehler in der Forderungsanmeldung kann zur Folge haben, dass der Insolvenzverwalter sie nicht anerkennt. Deshalb ist wichtig, die Vorgaben genau einzuhalten. Unter Umständen kann auch die Beratung durch einen Rechtsanwalt sinnvoll sein.
Was ist eine Insolvenzanfechtung?
Durch ein Insolvenzverfahren sollen die Forderungen der Gläubiger gemeinschaftlich und gerecht befriedigt werden. Deshalb wird das Vermögen des Schuldners ermittelt, verwertet und entweder aufgeteilt oder einem Insolvenzplan entsprechend verwaltet.
Hat der Schuldner aber im Vorfeld des Insolvenzverfahrens sein Restvermögen geschmälert, weil er die Forderungen eines Vertragspartners erfüllt hat, während die Forderungen anderer Vertragspartner noch offen sind, wäre das Grundprinzip verletzt.
Der Insolvenzverwalter kann solche Geschäfte deshalb anfechten und versuchen, sie rückgängig zu machen. Die Insolvenzanfechtung hat also den Zweck, Vermögensverschiebungen zu unterbinden und mögliche Ungerechtigkeiten bei der Befriedigung der Gläubiger zu verhindern.
Mehr Ratgeber, Tipps und Anleitungen:
- Reisegepäck per Paketdienst: Infos zum Schadensersatz
- Online-Bestellungen richtig zurückschicken – Infos und Tipps
- Wann die Stromkosten zu hoch sind und was sie senkt
- Infos zum Versicherungsstart in die Moped-Saison
- Mieten oder Kaufen: Pro & Contra in der Übersicht
- Was ist Energiecontracting? 2. Teil
- Was ist Energiecontracting? 1. Teil
- Rücktritt vom Kaufvertrag – Infos und Tipps, 3. Teil
Thema: Was tun, wenn ein Vertragspartner Insolvenz anmeldet?
Übersicht:
Fachartikel
Verzeichnis
Über uns
- Wissenswertes rund um den Surfstick - 16. April 2024
- Einen Anwalt beauftragen – Infos zu Auswahl, Leistungen und Kosten, Teil 3 - 15. März 2024
- Einen Anwalt beauftragen – Infos zu Auswahl, Leistungen und Kosten, Teil 2 - 20. Februar 2024
